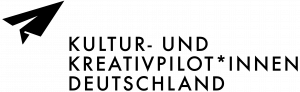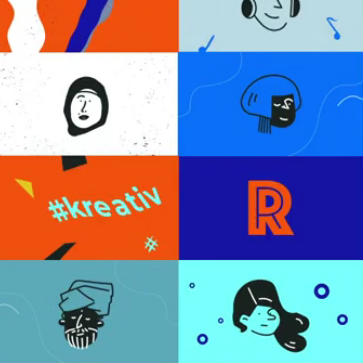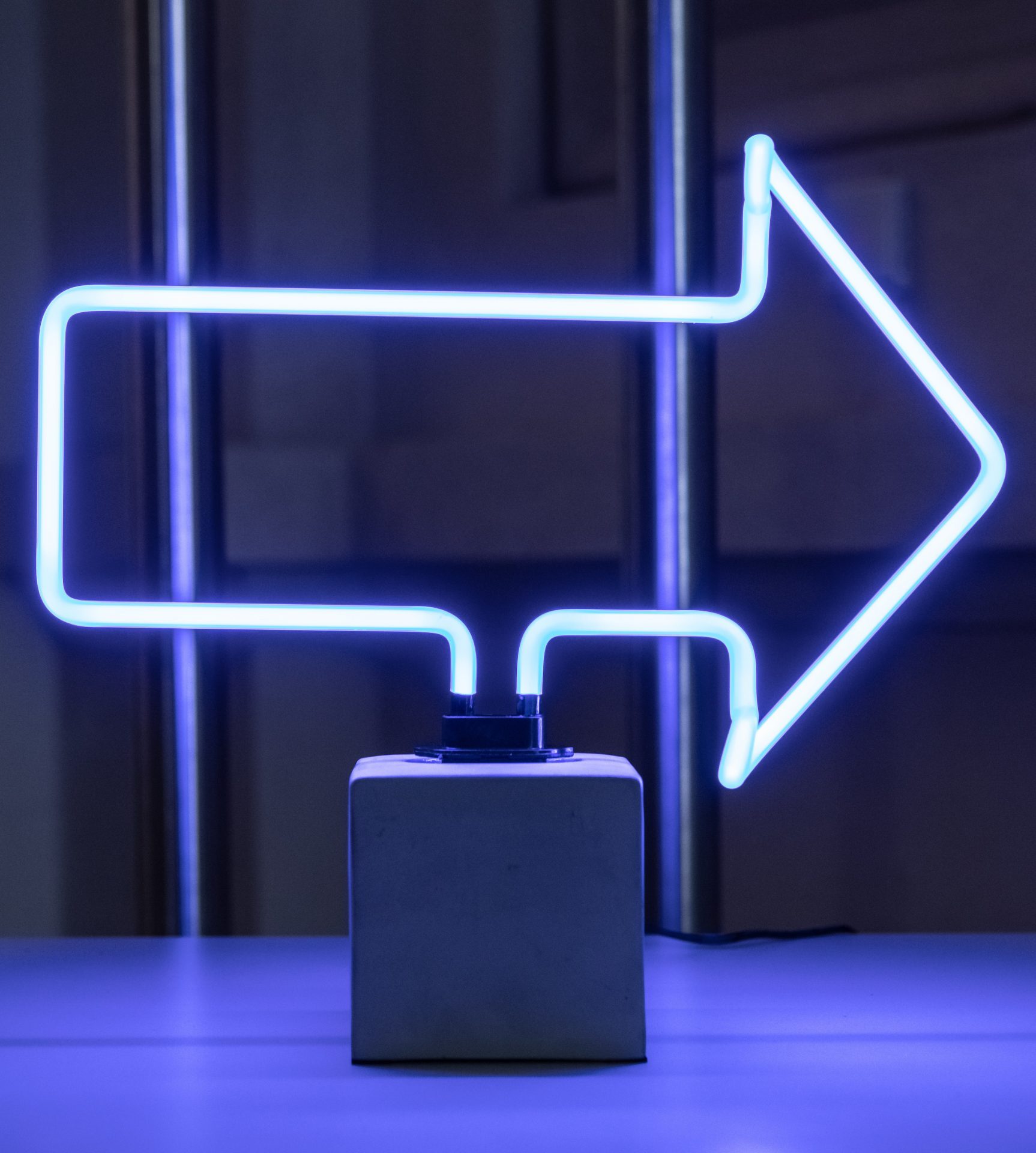Diversität und Antidiskriminierung sind Themen, die uns als Gesellschaft stark beschäftigen. Durch die Brille der Diskriminierungssensibilität wird besonders die Notwendigkeit klarer, Unternehmen, Projekte und die Zusammenarbeit mit Expert*innen zu reflektieren, neu zu strukturieren, inklusiver zu gestalten. Auch das u-institut sowie das Bundesprojekt Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland arbeiten an einem nachhaltigen Paradigmenwechsel und dessen Durchsetzung, um strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen.
Wie dieser Prozess funktioniert, wann Unsicherheiten dabei aufkommen und welche Zwischenergebnisse bisher gelungen sind, erklären Sylvia Hustedt, Joanna Szlauderbach, Katharina Wolf und Lisa Ratering aus dem Team der Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland im Interview.
LR: Sylvia, das u-institut hat vor einiger Zeit einen Antidiskriminierungsprozess gestartet. Wie kam das alles ins Rollen? Was war der Grundgedanke?
SH: Das Thema Antidiskriminierung ist bei uns ein Prozess. Ich kann gar nicht genau sagen, wann er angefangen hat. Das liegt daran, dass es ein weites Feld ist: Wenn du dir zum Beispiel das Thema Sexismus ansiehst, würde ich sagen, dass wir da schon sehr, sehr lange dran sind. Wenn es allerdings um andere Diskriminierungsthemen geht wie beispielsweise Rassismus, Ableismus oder Queerfeindlichkeit, dann muss ich ganz selbstkritisch sagen, dass sich das lange außerhalb meiner Wahrnehmung abspielte. Mitarbeiter*innen haben dann gesagt, wir müssen uns damit stärker beschäftigen. Ich glaube, da habe ich am Anfang gedanklich und bestimmt auch sprachlich jeden Fehler gemacht, der da nur gemacht werden kann: Von „Was hat das mit uns als Unternehmen zu tun?“, bis hin zu „Ich bin doch keine Rassistin!“.
Und parallel fand dann medial eine Entwicklung statt: Das Thema Antidiskriminierung hat im öffentlichen Diskurs eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Der hat offenbart, wie wenig weit wir da eigentlich als Gesellschaft sind. Daraufhin haben wir uns kritisch mit uns selbst auseinandergesetzt, gefolgt von der Erkenntnis, dass es sich nicht nur um ein Problem von Einzelnen handelt, sondern wirklich um eine systematische und strukturelle Diskriminierung von unterschiedlichen Gruppen, die auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Und der sich ein einzelner Mensch, der in diesem System sozialisiert wurde und eine Organisation, die aus solchen sozialisierten Wesen besteht, ehrlicherweise gar nicht entziehen kann. Und deshalb war es mir als Person und uns als Unternehmen wichtig, da sensibler zu werden und langfristig dafür zu sorgen, systematische und strukturelle Diskriminierung auf allen Ebenen in allen Bereichen in unserem Unternehmen und unseren Projekten zu bekämpfen.
Das Thema Antidiskriminierung hat im öffentlichen Diskurs eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Der hat offenbart, wie wenig weit wir da eigentlich als Gesellschaft sind.
LR: Wird das u-institut auch als Diskursteilnehmer wahrgenommen und gab es deswegen diese klare Entscheidung für die Auseinandersetzung?
SH: Das würde ich ehrlicherweise im Moment als vermessen bezeichnen (lacht). Es geht uns jetzt erstmal darum, uns intern damit zu beschäftigen. Das ist auch ein sensibles Thema, denn es ist natürlich der Kampf, den die Menschen, die tatsächlich negativ betroffen sind, führen. Sie sind es, die vieles offen gelegt und Argumentationsmuster entwickelt haben. Und ich glaube, das, was wir nach außen dazu beitragen können, lässt sich nur im Diskurs mit den Menschen, die tatsächlich marginalisiert sind, entwickeln.
LR: Inwiefern prägt dieser Antidiskriminierungsprozess des u-instituts die Auszeichnung und die Programmgestaltung der Kultur- und Kreativpilot*innen?
JS: Wir haben uns insbesondere in dem Projekt der Kultur- und Kreativpilot*innen entschieden, jetzt verstärkt diesen Weg zu gehen, weil wir an so vielen Stellen direkten Kontakt mit Menschen haben und das Programm in einem so großen Maße auf Kommunikation basiert, dass wir genau dort ansetzen können, um diskriminierungssensibler zu werden. Es geht im Grunde darum, dass wir das Programm noch mal mit anderen Augen anschauen. Wir haben ja lange gedacht, dass es sehr vielfältig und divers sei. Aber beim kritischen Hinsehen und auch mit diesem Wissen der verschiedenen Dimensionen von Diskriminierung wird uns in diesem Prozess immer wieder bewusst, dass wir am Ende dann sowohl in der Jury als auch bei den ausgezeichneten Unternehmen weitestgehend eine homogene Gruppe sind: Weiß, akademisch und privilegiert. Und mit diesem Bewusstsein gehen wir jetzt gerade um. Wir haben Task Forces gebildet, um bestimmte Bereiche des Programms kritisch zu betrachten und so zu verändern, dass wir dann einen möglichst diskriminierungssensiblen Raum kreieren können. Dazu gehört auch, dass wir uns als Team der Kultur- und Kreativpilot*innen permanent mit dem Thema auseinandersetzen und dazulernen. Und, dass wir in Zusammenarbeit mit anderen schauen: „Wie kommunizieren wir auf der Webseite, sind wir da offen genug? Schließen wir jemanden dadurch aus, wie wir Texte schreiben? Was kommunizieren wir in den sozialen Medien?
Wir wollen unseren Fokus explizit darauf richten, Unternehmer*innen anzusprechen, die sich noch nicht in unserem Umfeld befinden. Zudem arbeiten wir gerade an einem Code of Conduct, weil wir auch ein großes Netzwerk mit Menschen haben, die wir auf unsere Reise mitnehmen wollen. So planen wir zum Beispiel für die Jury Briefings anzufertigen, damit über die Auseinandersetzung mit dem Thema ein diskriminierungssensibler Raum in den Auswahlgesprächen entstehen kann. Diejenigen, die die Vorauswahl treffen werden, bekommen ein explizites Coaching, um ihre eigenen Wahrnehmungsdefizite zu erkennen.
Dazu gehört auch, dass wir uns als Team der Kultur- und Kreativpilot*innen permanent mit dem Thema auseinandersetzen und dazulernen.
LR: Ich würde dazu noch ergänzen, dass die Kultur- und Kreativpilot*innen als Auszeichnung auch dafür stehen, dieser diversen, heterogenen Branche, der Kultur- und Kreativwirtschaft, ein Gesicht zu geben und dass es deshalb auch in dieser Hinsicht so wichtig ist, niemanden auszuschließen.
JS: Ja, natürlich. Das eine ist, nach innen und in der Kommunikation sensibel zu werden. Das aber auch nach außen zu tragen und sichtbar werden zu lassen, auch um gesellschaftliche Realitäten abzubilden. Wir können damit außerdem unser Netzwerk um sehr wertvolle Impulse erweitern, die durch marginalisierte Menschen gesetzt werden.
LR: Wie findet denn die Auseinandersetzung mit dem Thema konkret statt? Wie wird da an Formaten und Änderungsprozessen gearbeitet? Und welche Unsicherheiten gibt es dabei?
KW: Dafür setzen wir tatsächlich an ganz unterschiedlichen Stellen an. Wir lassen uns bei diesem Prozess von externen Expert*innen begleiten, die selbst marginalisierten Gruppen zugehörig sind, die unsere Sprache überprüfen, uns inhaltliche Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten geben und die uns weiterbilden. Wir haben Diskussionsrunden gegründet, bilden uns über interne Workshops und lesen Literatur, die wir in Kleingruppen reflektieren. Dadurch versuchen wir, uns einen kritischen Blick auf unsere eigenen Prozesse anzueignen. Wir prüfen und überarbeiten zurzeit die Ansprache in unseren Kommunikationsmaßnahmen und bemühen uns dabei, uns in Form und Sprache diskriminierungssensibel fortzubewegen. Wir arbeiten an einem Code of Conduct und an Workshops, die wir für unser Netzwerk anlaufen lassen. Klar, wir sind auch unsicher, es gibt immer Wahrnehmungsdefizite, wenn dieser Blick nur aus der privilegierten Perspektive besteht. Aktuell sind wir ein Organisationsteam, in dem die Mehrheit der Personen nicht marginalisierten Gruppen angehört. Klar ist es auch, dass deshalb die Ansprache manchmal schwierig ist, wir sind da in einem Lern- und Entwicklungsprozess. Wir freuen uns deshalb über Feedback, wenn jemand auf uns zukommt und uns auf etwas aufmerksam macht. Wir wollen weiter lernen und uns ganzheitlich mit dem Thema beschäftigen.
JS: Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns in einem Gefühl der Unsicherheit befinden. Wir verspüren die Unsicherheit, weil wir etwas neu, etwas anders machen und den tradierten Weg verlassen.
Wir lassen uns bei diesem Prozess von externen Expert*innen begleiten, die selbst marginalisierten Gruppen zugehörig sind, die unsere Sprache überprüfen, uns inhaltliche Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten geben und die uns weiterbilden.
LR: Hast du Situationen im Kopf, wo du solche Unsicherheiten in der letzten Zeit ganz stark gespürt oder gesehen hast?
JS: Jetzt in dem Interview zum Beispiel. Die richtige Ausdrucksweise, die richtigen Worte dafür zu finden. Aber auch, wenn wir Jurymitglieder aus marginalisierten Gruppen anfragen und für uns gewinnen wollen. Sprache ist da vor allem ein großes Unsicherheitsfeld.
SH: Bei dem Thema der Ansprache der Jury hatten wir eine Diskussion, die auch stark durch Unsicherheit geprägt war. Wenn wir unsere Jury diverser gestalten wollen, dann möchten wir Menschen nicht nur deshalb ansprechen, weil sie einer marginalisierten Gruppe angehören und damit unsere Jury diverser machen. Unser allererstes Ziel ist es stattdessen, Jurymitglieder zu finden, die mit ihrer Expertise qualifiziert für die Auswahlgespräche sind und da gibt es ausreichend Menschen, die das sind und zugleich marginalisierten Gruppen angehören. Da müssen wir nur in anderen Netzwerken suchen. Aber es besteht das Bedenken, plötzlich den Eindruck zu erwecken, wir sprechen dich jetzt nur an, weil wir eine gewisse Quote in der Jury erreichen wollen. Wie wir das in der Außenkommunikation oder im direkten Kontakt hinbekommen, das ist ein wahnsinnig sensibles und schwieriges Thema.
LR: Das ist der Punkt, an den wir immer wieder kommen: Wie finden wir die richtigen Worte, wie finden wir den richtigen Ausdruck?
SH: Und wie machen wir unsere Haltung deutlich?
Das ist der Punkt, an den wir immer wieder kommen: Wie finden wir die richtigen Worte, wie finden wir den richtigen Ausdruck? Und wie machen wir unsere Haltung deutlich?
LR: Wir haben uns ja dafür Hilfe an die Seite geholt, so dass wir eben nicht nur aus unserer Perspektive in die Ansprache gehen und sensibler werden können. Welche Expert*innen oder welche Organisationen sind es denn?
KW: Wir haben unseren ersten internen Anti-Rassismus-Workshop mit einem Berliner Non-Profit urchgeführt. Jetzt arbeiten wir mit DisCheck zusammen, einem Beratungskollektiv für diskriminierungssensible & intersektionale Mediengestaltung, die unsere Kommunikationsmittel überprüfen und uns auch bei unserer Strategie, unseren Konzepten, der Juryansprache und vielem mehr zur Seite stehen. Außerdem sind wir im permanenten Austausch mit einigen Kolleg*innen bei uns im Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, dazu wissenschaftliche Abschlussarbeiten geschrieben oder sich journalistisch damit auseinandergesetzt haben.
SH: Expert*innen von außen sind da extrem wichtig. Es gab ein ganz konkretes Beispiel, an dem deutlich wurde, dass wir, wenn wir nur aus unserer Perspektive in die Aktion gehen, ganz viele Sachen nicht auf dem Schirm haben, weil wir selbst nicht von mehrfacher Marginalisierung negativ betroffen sind. Ich überspitze es mal ein bisschen: Wir lebten in dieser naiven Vorstellung, dass wir die Jury diverser besetzen und dann sind die Titelträger*innen diverser und dann sind vielleicht die Probleme gelöst. Was wir aber nicht bedacht haben ist, dass wir dafür auch erstmal eine Umgebung schaffen müssen, in der sich Angehörige marginalisierter Gruppen überhaupt sicher fühlen, daran hatten wir nicht gedacht. Ein konkretes Beispiel war, dass es darum geht, dass wir die Auswahlgespräche ja – sofern sie analog stattfinden – an unterschiedlichen Standorten in Deutschland durchführen. Dann gab es einen Hinweis von Expert*innen, dass wir ganz genau darauf achten sollen, welche Regionen wir dafür auswählen. Weil es in Deutschland durchaus Orte gibt, in denen sich Angehörige einiger marginalisierter Gruppen nicht sicher fühlen. Das hätte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber wir wissen natürlich alle, dass das Argument durchaus seine Berechtigung hat. Ich finde, das ist so ein Beispiel, das relativ deutlich macht, warum es wirklich wichtig ist, mit Expert*innen zusammenzuarbeiten, die wissen, worüber sie sprechen.
LR: Was wurde denn bisher schon umgesetzt und was haben wir bereits geschafft, innerhalb dieses Prozesses?
SH: Ich glaube, es muss zwischen innen und außen unterschieden werden. Also von außen finde ich, dass das Team da unglaublich viel geschafft hat. Expert*innen ins Boot zu holen, die Kommunikationsmaßnahmen nach und nach neu aufzustellen, zu recherchieren, wo es geeignete Leute für die Jury gibt. Ich finde, in der kurzen Zeit ist da, neben dem Tagesgeschäft, wirklich schon Gutes geleistet worden. Im Inneren des Unternehmens sind wir dennoch am Anfang des Prozesses. Wir müssen ja auch sehen, wer heute dieses Gespräch gerade führt: Das sind vier weiße, privilegierte Frauen. Das zeigt, was wir auch noch zu leisten haben. Auch da ist es ein Prozess und es geht nicht nur darum, in der zukünftigen Personalauswahl zu schauen, das Team diverser zu besetzen. Wir müssen bei uns anfangen, damit wir ein Unternehmen haben, was auch für Menschen aus marginalisierten Gruppen einen guten Raum bietet. Und da, würde ich sagen, sind wir noch am Anfang.
JS: Viele Maßnahmen kommen jetzt: Die Auswahlgespräche, das Mentoringprogramm, in denen wir es schaffen müssen, Safer Spaces einzurichten, so dass Diskriminierung keinen Platz hat. Was ich aber merke ist, dass es ein wichtiges tägliches Thema geworden ist. Die Reflektion darüber gehört zu unserem Arbeitsalltag. Das ist eine gute Errungenschaft.
Wir müssen bei uns anfangen, damit wir ein Unternehmen haben, was auch für Menschen aus marginalisierten Gruppen einen guten Raum bietet. Und da, würde ich sagen, sind wir noch am Anfang.
LR: Welche Ziele hat dieser Antidiskriminierungsprozess?
SH: Ich würde mir wünschen, dass wir uns irgendwann verschiedenen Diskriminierungsformen, sowohl systemisch, institutionell als auch individuell, so bewusst sind, dass Antidiskriminierung mehr und mehr im Unternehmen mitläuft und funktioniert. Das ist natürlich ein übergeordnetes gesellschaftliches Ziel aber wir können als Personen, als Unternehmen, als Organisation im Kleinen daran arbeiten. Die Gesellschaft besteht aus Menschen und das bedeutet, dass wir bei uns selbst anfangen können. Bei sich als Person und dann bei sich als Organisation. Das wird immer ein Prozess sein und wir müssen uns da immer kritisch reflektieren – aber das wäre das Ziel: ein Setting zu schaffen, in dem sich alle sicherer fühlen, wissend, dass wir diesen Prozess ernst nehmen und in dem alle Lust haben, miteinander zu arbeiten.
Das wird immer ein Prozess sein und wir müssen uns da immer kritisch reflektieren – aber das wäre das Ziel: ein Setting zu schaffen, in dem sich alle sicherer fühlen.