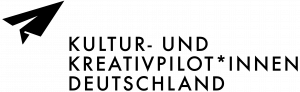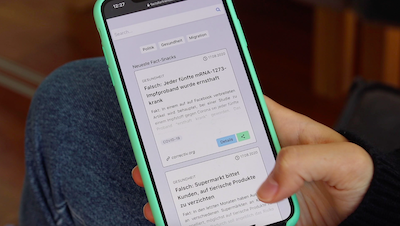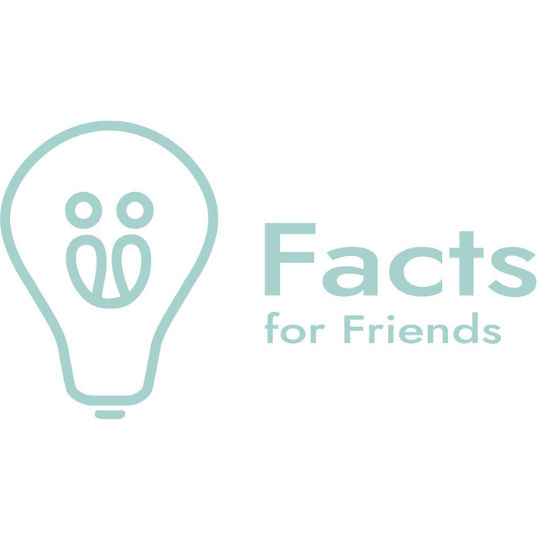Laura Mohns Schwester hat das Down-Syndrom und so kommt sie immer wieder mit dem Thema Inklusion in Berührung. „Kinder mit dem Down-Syndrom lernen später zu sprechen als andere und Gebärden können da sehr hilfreich sein. Das bestehende Lehrmaterial war nicht nur aus der gestalterischen Perspektive nicht so toll. Es machte den Kindern auch keinen Spaß — wenn Kinder Spaß haben, dann lernen sie aber lieber.“
Mohn ist Kommunikationsdesignerin und ihr kam die Idee zu den Daumenkinos, die beim Durchblättern zum animierten Comic werden und jeweils eine Gebärde zu einem Begriff demonstrieren. Auf dem Front-Cover steht der Begriff geschrieben, auf dem Back-Cover ist er als Symbol bildlich erklärt. „Es musste etwas Neues her, was ein bisschen interaktiver ist und was nicht nur Kindern mit Behinderung Spaß macht, sondern auch Kindern ohne Behinderung, denn nur so kann Inklusion funktionieren: Wenn alle mitmachen.“
Zusammen mit Maria Möller gründet sie talking hands. „Wenn wir Menschen schon im Kindesalter das Inklusionsthema mit auf den Weg geben, dann werden daraus Jugendliche und Erwachsene, die keine Hemmungen mehr haben, sich mit Behinderungen auseinanderzusetzen“, sagt Möller. Das eröffnet die Möglichkeit, von Generation zu Generation eine tolerantere Gesellschaft zu werden.
Die beiden Gründer*innen kennen sich aus dem Studium. Danach arbeiten sie in unterschiedlichen Werbeagenturen. Nebenher starten sie 2020 talking hands. Als das Projekt aber „zu einem richtigen Ding“ wird, geben sie ihre Jobs auf und betreiben es fortan hauptberuflich. Laura ist für die Gestaltung zuständig, Maria führt die Geschäfte, macht Akquise und versucht, talking hands in die Welt zu bringen.“
„Sie kann nach zwei Schlaganfällen nicht mehr sprechen und muss ja trotzdem kommunizieren.“
Warum aber entwickeln sie keine App? Das scheint auf den ersten Blick moderner. „Am Anfang war das die Idee. Als ich mich jedoch mit Eltern und Erzieher*innen unterhalten habe wurde klar, dass ein Print-Produkt für die Altersklasse zwischen 3 und 7 Jahren die bessere Alternative ist“, sagt Mohn. Nicht in jeder Einrichtung sind genügend Tablets vorhanden und vor allem sollten die Kinder nicht noch mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen. Eine App für ältere Kinder und Erwachsene ist jedoch in Planung.
Momentan werden die Daumenkinos vor allem in Kindergärten und logopädischen Praxen angewendet. Aus letzteren kommt das Feedback, dass die Daumenkinos das erste Lehrmaterial seien, „auf das die Kinder richtig Lust hätten.“ Aber auch andere Anwendungsbereiche sind denkbar. Marias Oma zum Beispiel benutzt sie im Altersheim, „Sie kann nach zwei Schlaganfällen nicht mehr sprechen und muss ja trotzdem kommunizieren.“
Der Schlaganfall eines Freundes, der damals 15 Jahre alt war, brachte Gernot Sümmermann dazu, zusammen mit Manuel Wessely das Unternehmen Cynteract zu gründen.
Schon in seiner Schulzeit entwickelte Sümmermann im Rahmen von Jugend Forscht einen Handschuh, der Fingerbewegungen nicht nur messen, sondern auch Feedback geben kann. Durch den Freund haben sie mitbekommen, dass die Reha nicht nur ein langwieriger Prozess ist, sondern auch ein sehr monotoner. Es kam die Idee, den Handschuh spielerisch für die Reha-Übungen einzusetzen. „Warum sollte er immer nur einen Ball drücken — und kann mit der gleichen Bewegung nicht zum Beispiel eine Rakete steuern?“
Der Handschuh ist zum einen für die Reha nach chirurgischen Fällen wie zum Beispiel Sehnenverletzungen geeignet, zum anderen für neurologische, wie eben Schlaganfälle oder Querschnittslähmungen. Die Spiele werden mit Mediziner*innen und Physiotherapeut*innen entwickelt und auch das Feedback der Patient*innen fließt mit ein. Je nach Bedarf werden die Spiele so entwickelt, dass sie die entsprechenden Bewegungen fordern und fördern. Auch die Fortschritte werden gemessen.
Sümmermann studiert in Aachen Maschinenbau, Wessely Informatik. Die beiden wohnten im gleichen Haus und haben sich dort auch kennengelernt. Ihre Kompetenzen ergänzen sich für Cynteract perfekt: Sümmermann ist für die Hardware zuständig, Wessely für die Software.
„Jegliche Fingerbewegung kann gemessen werden, sei es ein Fingerspreizen oder die Krümmung der einzelnen Fingerglieder.“
Der Unterschied zu vergleichbaren Handschuhen? „Er ist super portabel, er wiegt nur 60 Gramm, kann in der Hosentasche mitgenommen werden. Er ist ein richtiges Smart Textile. Wir haben eine große Anzahl von Sensoren darin untergebracht. Jegliche Fingerbewegung kann gemessen werden, sei es ein Fingerspreizen oder die Krümmung der einzelnen Fingerglieder.“
Durch verschiedene Tweaks ist es den beiden gelungen, die Kosten von 5.000 auf 500 Euro zu reduzieren, denn das Ziel ist, dass jede*r, der den Handschuh braucht, ihn auch zuhause haben kann, und auch für Kliniken so günstig wie möglich ist. Er ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, bald sollen die Kosten durch die Krankenkassen erstattet werden.
Gibt es einen extra Kick, Impact Entrepreneur*in zu sein? „Definitiv — wenn wir zum Beispiel zu einem*einer unserer Patient*innen fahren, der*die ab dem 6. Halswirbel querschnittsgelähmt ist und sehen, wieviel Spaß er*sie beim Training mit den Handschuhen hat oder beobachten, wie Patient*innen auch nachts und am Wochenende trainieren und so schneller ihren Alltag zurück erobern, wieder selbst Zähne putzen oder ein Glas heben können, dann ist das eine besondere Motivation.“
Auch Gülay Ulaş in Hamburg findet in Social Entrepreneurship eine besondere Motivation. Sie möchte eher etwas an die Gesellschaft zurückgeben, als noch mehr Produkte zu verkaufen, die eigentlich keiner braucht. „Ich bin in Hamburg aufgewachsen, zwar in einer Arbeiter*innenfamilie, aber trotzdem gehörst du zu den reichsten Menschen der Welt. Mit unserem Bildungs- und Gesundheitssystem sind wir privilegiert.“ Ulaş arbeitet zuerst im Bereich Marketing für Agenturen. „Ich wollte aber irgendwann nicht mehr dazu beitragen, dass Einzelpersonen oder Konzerne noch reicher werden.“ Seit zwei Jahren bewegt sie sich nun ausschließlich in der Obdachlosenhilfe und schon 2018 startet sie mit drei Mitgründer*innen das Projekt GoBanyo: einen Duschbus für Obdachlose.
„Für Menschen, die auf der Straße leben bedeutet es die Möglichkeit, dass sie einen gewissen Standard aufrechterhalten und sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen können.“
Im Stadtteil Ottensen betreibt sie ebenfalls seit 2018 das Café Sonnenschein, in dem Obdachlose am Sonntag Kaffee und Kuchen kriegen. GoBanyo-Mitgründer Dominik Bloh hat früher selbst auf der Straße gelebt. Er beobachtet im Café, dass die Obdachlosen zuerst auf die Toilette gehen, um sich zu waschen, bevor sie Hallo sagen und bestellen. Dominik kannte die Idee mit dem Duschbus aus den USA und brachte die Idee nach Hamburg.
„Waschen ist Würde“ steht auf der Website von GoBanyo. „Das soll nicht heißen, dass die Menschen, die zu uns kommen, vorher keine Würde besitzen und wir sie ihnen zurückgeben. Für Menschen, die auf der Straße leben bedeutet es aber die Möglichkeit, dass sie einen gewissen Standard aufrechterhalten und sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen können. Sie können zu uns kommen, bevor sie ein Vorstellungsgespräch haben, manchen gibt der Besuch bei uns Struktur für den Tag.“
Jeder Gast bekommt etwa eine halbe Stunde Zeit. Im Bus gibt es drei Bäder, in Zeiten von Corona dürfen jedoch nur zwei benutzt werden, um Begegnungen im Gang zu vermeiden. Der Bus steht zu bestimmten Zeiten verlässlich an bestimmten Orten. Zusätzlich gibt es ein Duschdorf mit drei Containern in der Glacischaussee in St. Pauli. Der Bedarf ist groß, Bus und Duschdorf sind immer ausgelastet. Am nächsten mobilen Projekt wird gearbeitet.
Eine besondere Funktion übernimmt bei GoBanyo das Design. „Wir wollten einem Thema, zu dem nicht gerne hingeschaut wird, das eher als grau und trist wahrgenommen wird, ein fröhliches Gesicht geben. Wenn Kinder vorbeilaufen, dann fragen sie ihre Eltern, was das denn sei — es weckt Interesse.“
Katharina Anne Klimkeit und Valerie Scholz wollen das Interesse der Menschen auf Fakten lenken. „Mein Vater hat immer diese Fake-News-Kettenbriefe in WhatsApp-Gruppen bekommen. Da habe ich erkannt, dass es einen Bedarf gibt, gegen solche Falschnachrichten etwas zu tun“, sagt Katharina Anne Klimkeit, die zusammen mit Valerie Scholz die Plattform „Facts for Friends“ gründet.
Die Idee für das Startup stammt aus dem Hackathon gegen das Coronavirus, der von der Bundesregierung Anfang 2020 initiiert wurde. Sie wurde ursprünglich von einer anderen Teilnehmerin eingereicht. Wegen der Geschichte mit ihrem Vater habe sich Klimkeit jedoch sofort dazu hingezogen gefühlt. „Je mehr ich in das Thema eingetaucht bin, desto mehr ist mir aufgefallen, wie relevant es ist.“ Ihre Freundin Valerie Scholz schließt sich Klimkeit nach dem Hackathon an. „Als Journalistin hatte ich die Erfahrung gemacht, dass der Journalismus sich wenig weiterentwickelt, das viel in alten Mustern passiert“, sagt sie.
Die beiden Gründerinnen gehen schon zusammen zur Schule. Danach trennen sich ihre Wege zuerst. Scholz studiert Kulturwissenschaften und schließt einen Masterstudiengang in Journalismus an, Klimkeit BWL und macht ihren Master in Entrepreneurship und Innovationsmanagement. Vor Facts for Friends gründete sie schon zwei andere Startups: Mit 18 Jahren importiert sie hawaiianischen Kaffee, noch heute handelt sie mit Weinen aus dem Rheingau.
Als sich ihre Wege wieder kreuzen, machen sie ihre unterschiedlichen Kompetenzen zum perfekten Match. Ohne die beiden wäre die Idee, auf der die Plattform nun basiert, nach dem Hackathon wohl eingeschlafen. Die Besonderheit ihrer Idee: Es werden die Faktenchecks anderer, renommierter Portale in das komprimiert, was Klimkeit und Scholz „Fact-Snacks“ nennen: übersichtliche, gut verständliche Zusammenfassungen. Denn ein Problem, warum sich nur wenige für Faktenchecks interessierten sei, dass sie nicht attraktiv aufbereitet und wenig verständlich seien. Ihre Quellen sind vom IFCN, dem International Fact-Checking Network verifiziert. „Wir müssen natürlich die Sicherheit haben, dass unsere Quellen verlässlich sind, dass wir nicht selbst unsinnigen Content weiterverbreiten.“
„Wir wollen Factchecking sexy machen, um auch neue, jüngere Zielgruppen zu erreichen, die sich vielleicht gerade noch nicht dafür interessieren.“
Im Moment entscheidet noch Scholz, welche Inhalte es auf die Seite schaffen — nach Relevanz, den Themen des Tages. In Zukunft soll künstliche Intelligenz in Form von „Natural Language Processing“ genutzt werden, um wichtige Themen schnell zu identifizieren und den FactSnack Output zu erhöhen. „Wir sind eher Distributoren und wollen Faktenchecks an solche Leser*innen bringen, die sie normalerweise nicht lesen würden, weil sie in langen komplexen Formaten daherkommen. Wir wollen Factchecking sexy machen, um auch neue, jüngere Zielgruppen zu erreichen, die sich vielleicht gerade noch nicht dafür interessieren.“
Dabei ist den beiden klar, dass sie nicht Querdenker und Co. erreichen können und werden. „Wir wollen und können aber Menschen erreichen, die verunsichert sind und sich informieren möchten. Viele wissen aber nicht um die Verfügbarkeit von Faktenchecks. Bis vor dem Hackathon habe ich auch noch keine gelesen, obwohl ich mich durchaus für eine informierte Bürgerin halte“, sagt Klimkeit.
Es wird also an neuen, visuell attraktiven und teilwürdigen Formaten gearbeitet, die mindestens genauso gerne geteilt werden (#ErzählMirKeineMärchen) wie die entsprechenden Fake News. Vor allem die Gen Z soll so angesprochen werden, denn „die ist in Communities aktiv, die etwas verändern wollen. Wir erhoffen uns einen Welleneffekt aus diesen Communities heraus. „Im Moment werden Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn bespielt. TikTok ist ein nächstes Ziel.
Doch um hochwertigen und ansprechenden Content zu erstellen, der es heute durch die Unmengen an Informationen schafft, braucht es weiteres Kapital. Facts for Friends ist nicht unbedingt ein klassischer Business Case für Venture Capital, die in Bezug auf ihren ROI einen Hockey-Stick-Effekt erwarten. Klimkeit schaut aber positiv in die Zukunft: „Wir wollen DIE bekannte Plattform für nutzerfreundliches Fact-Checking werden und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Business Angels, Stiftungen, philanthropischen Investoren, dem Bund und der EU.“
Fotos: Julia Schwendner, Harald Schröder, Jerome Gerull
Text: Björn Lüdtke