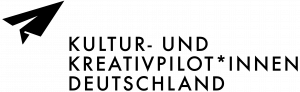„Es gibt da doch diese Schwarze Barbie aus dem Film ‚Küss den Frosch‘?“ Als Olaolu Fajembola und Tebogo Niminde-Dundadengar 2017 auf Investorensuche waren, stießen sie nicht nur einmal auf verwunderte Rückfragen. „Ja. Eine. Nur eine! Genau das ist das Problem“, antworteten die beiden Wahlberlinerinnen. Ihre Geschäftsidee: Ein Online-Shop, der gebündelt Spielsachen und Bücher anbietet, die nicht die gängigen Prototypen von Geschlecht, Hautfarbe, Familienkonstellation oder Religion bedienen. Das, was die beiden Schwarzen Frauen in ihrer eigenen Kindheit im Deutschland Mitte der 1980er Jahre nicht hatten – und auch mehr als 30 Jahre später immer noch fehlte. „Nicht nur nach Schwarzen oder asiatischen Puppen, auch nach Kinderbüchern, in denen nicht-weiße Kinder die Hauptrolle spielen, muss man heute noch sehr lange suchen – vieles gibt es nur auf Englisch oder in Antiquariaten“, sagt Tebbi, wie sie alle nennen. Ebenso unterrepräsentiert seien auch muslimische Kinder, solche mit Behinderungen oder aus queeren Familienverhältnissen.
„Nicht nur nach Schwarzen oder asiatischen Puppen, auch nach Kinderbüchern, in denen nicht-weiße Kinder die Hauptrolle spielen, muss man heute noch sehr lange suchen“
Mit ihrem Shop sollten Eltern nicht mehr suchen müssen, sondern finden. Aber auch, wenn den möglichen Geldgeber*innen das Problem im Verlauf der Gespräche klar wurde, taten sie sich schwer damit, eine echte Notwendigkeit in der Geschäftsidee zu sehen. Irgendwann waren es die beiden Mütter leid: „Wir haben unser Geld zusammengekratzt und die Sache selbst in die Hand genommen“, erzählt Tebbi. Im August 2018 ging der Tebalou-Shop online. Olaolu bemerkt: „Die Resonanz aus unseren Communities war von Anfang an sehr gut“. Neben Eltern gehören auch immer mehr Kitas und Kindergärten zu den Tebalou-Kunden. „Wir können von den Geschäften leben“, sagt Tebbi. Geholfen bei ihrer rasanten Entwicklung habe auch die Auszeichnung als Kultur- und Kreativpiloten Deutschland: „Für einige Leute waren wir trotz unseres Erfolgs in der ‚Zwei Frauen versuchen mal was‘-Nummer gefangen“, sagt Tebbi. „Mit der offiziellen Bestätigung der Bundesregierung, dass das was wir machen, kreativ, gut und wichtig ist, werden wir nun von allen ernst genommen“, fügt Olaolu hinzu.
„Die Resonanz aus unseren Communities war von Anfang an sehr gut“
Das spiegelt sich auch in vermehrten Anfragen für Beratungen und Workshops zum Thema Diskriminierung und Rassismus wider, die durch den Mord an George Floyd und die weltweiten Anti-Rassismus-Proteste noch einmal stark zugenommen haben. Solche Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich „Diskriminierung in der frühkindlichen Bildung“, wollen die Psychologin Tebbi und die Kulturwissenschaftlerin Olaolu künftig auch weiter ausbauen. Spielzeug und Bücher, die Diversität als Selbstverständlichkeit darstellen, seien dabei die elementare Grundlage, sagt Olaolu. Aber auch direkte Intervention, wenn Kinder rassistische Bemerkungen fallen lassen. Gerade Dreijährige hätten ein großes Gerechtigkeitsgefühl – Kitas und Kindergärten seien daher ideale Orte, um mit Gesprächen über das Thema anzufangen. Oft seien die Kinder richtiggehend empört, wenn sie begriffen haben, was Rassismus ist, und wollen es besser machen, sagt Olaolu. Und das ist der wichtigste Schritt für die nötige gesellschaftliche Veränderung.
„Oft sind die Kinder richtiggehend empört, wenn sie begriffen haben, was Rassismus ist, und wollen es besser machen“
Auch Jonathan Funke setzt darauf, dass mehr Verständnis für eine Sache das Verhalten von Menschen ändert – und die Welt so fairer macht. Der 23-jährige Gründer des Unternehmens tip me hat ein Trinkgeldsystem für Näher*innen und Arbeiter*innen in der Textilindustrie entwickelt. Per Software-Plugin können Kund*innen beim Bezahlen von Kleidung in einem Online-Shop mit einem einfachen Klick ein Trinkgeld hinterlassen. Auf die Idee kam Jonathan im April 2014, kurz nach einer Demonstration gegen die Eröffnung einer Primark-Filiale am Berliner Alexanderplatz. „Wir standen da Menschenmassen entgegen, die kreischend wie auf einer Autogrammstunde einer Boyband darauf warteten, dass der Markt eröffnet“, erinnert er sich. „Nur drei Prozent, von dem, was du für ein T-Shirt bezahlst, kommt bei den Menschen an, die es produzieren“ stand auf den Flyern, mit denen Jonathan auf die Schnäppchenjäger zugegangen ist. „Diejenigen, die das gelesen haben, waren echt überrascht: Sie dachten, die spottbilligen Textilien fallen einfach aus irgendeiner Maschine.“
„Nur drei Prozent, von dem, was du für ein T-Shirt bezahlst, kommt bei den Menschen an, die es produzieren“
Als Jonathan am nächsten Tag in einem Café einen Kaffee bestellte, über die Ungerechtigkeit der Welt sinnierte und dem lächelnden Kellner Trinkgeld gab, dachte er: Moment, wieso funktioniert das nicht auch auf einer globalen Lieferkette? Wir leben doch im 21. Jahrhundert, da müsste es doch per Handy oder Internet möglich sein, Näher*innen in Pakistan Trinkgeld für das toll genähte T-Shirt zu geben!? Der damalige Schüler recherchierte, fand heraus, dass es so etwas noch nicht gab und beschloss es selbst zu entwickeln. Heute, nach sechs Jahren, dem Abitur und Studium der Gründer*innen, zwei tip-me-Prototypen (einer davon aus Pappe), einem Softwareentwicklungsprozess und der Auszeichnung als Kultur- und Kreativpilot, steht tip me unmittelbar vor dem großen Markteintritt. „Unser Plugin funktioniert schon in den Shops von drei kleineren Firmen. Jetzt geht es daran, mit mehr Labels das Leben von tausenden Näher*innen zu verändern“, sagt Jonathan. Er ist zuversichtlich: Mit großen Outdoor- und Modemarken seien sie bereits in ernsthaften Gesprächen.
„Jetzt geht es daran, mit mehr Labels das Leben von tausenden Näher*innen zu verändern“,
Unternehmen bezahlen tip me für die Software, die globalen Transaktionen und die Verifizierung der Daten. „Wir sammeln das Trinkgeld und können es auch direkt an die Arbeiter auszahlen – entweder auf das Mobiltelefon oder auf das Bankkonto, sofern das vorhanden ist“, sagt Jonathan. Der tip me-Zertifizierungsdienst überprüft die Daten in regelmäßigen Abständen, damit sichergestellt ist, dass das Geld auch wirklich bei den Arbeiter*innen ankommt. Der Modemarkt soll aber nur der Anfang sein. „Mittelfristig wollen wir uns auch auf den Food-Bereich erweitern“, sagt der tip me-Gründer. Und irgendwann, so seine Vision, soll tip me ein großes soziales Unternehmen sein, dass die gesamte Lieferkette eines Unternehmens und alle Zahlungen darin transparent aufzeigen kann. Das wäre die Basis für ein faireres Wirtschaften. Das tip me-Team glaubt, diese Herkulesaufgabe zu schaffen: „Jede*r zweite Konsument*in nutzt tip me. Weil wir sie anders erreichen als Siegel oder lange CSR-Berichte – wir schaffen Verbindungen zwischen Menschen und berühren die Konsumenten damit emotional.“
„Wir schaffen Verbindungen zwischen Menschen und berühren die Konsumenten damit emotional.“
Aktuell verschiebt tip me kleinere vierstellige Eurobeträge an Trinkgeld. Aber bereits die in europäischen Augen kleinen Summen machen einen großen Unterschied: „Jeder zweite Mensch auf der Erde verdient nur fünf Euro pro Tag. Da hat bereits ein ausgezahltes Trinkgeld von einem Euro eine große Wirkung“, sagt Jonathan. Für ihn sei es aber auch schon ein Erfolg, wenn ein Unternehmen seine Kunden mit tip me überhaupt dazu bringt, darüber nachzudenken, wo und von wem ein Produkt hergestellt wurde. „Früher oder später wird dieses Bewusstsein bei den meisten dazu führen, ethischer und nachhaltiger zu konsumieren“, ist er überzeugt. „Und darauf kommt es an.“
„Jeder zweite Mensch auf der Erde verdient nur fünf Euro pro Tag. Da hat bereits ein ausgezahltes Trinkgeld von einem Euro eine große Wirkung“