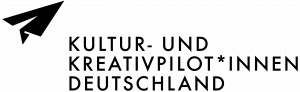Schon wieder so eine Schnapsidee. Vater Pichler war nicht amüsiert von dem, was ihm seine Tochter erzählte. Erst das Literatur- und Philosophiestudium. Und jetzt wollte das Kind auch noch Theater machen „Das war schwierig für ihn“, sagt Leonie Pichler. „Mein Vater ist Unternehmer. Er betreibt ein Elektrogeschäft, das schon sein Vater gegründet hat. Was ich machte, war für ihn brotlose Kunst.“
Vor allem, weil Leonie eine ganz eigene Art von Theater vorschwebte. Eines, bei dem die Schauspieler nicht auf einer Bühne agieren, vor vollen Rängen und Abonnenten-Publikum. Sie bringt Schauspieler und Publikum an immer neue, ungewöhnliche Orte: Hotelzimmer, Eisenbahnzüge, Schwimmhallen. Bluespots Productions heißt das Projekt, weil die Inszenierungen – im übertragenen Sinne – blaue Flecken verursachen sollen. „Wir wollen fühlbare Eindrücke hinterlassen.“

Die Idee entstand, als Leonie nach dem Studium zwei Jahre in Pittsburgh Literatur und Theater unterrichtete. „Einen Tag in der Woche ging es um langweilige Interpretationen von Texten, und dann wieder einen Tag, an dem die Texte im Theater wiedergegeben werden. Einen Tag, an dem es um Atmung geht, um Stimme, und darum, wie sich Hände bewegen – das hat mir sehr viel mehr gegeben.“ Also schlug sie das Angebot für eine Promotionsstelle in den Wind. „Ich wollte meine Jahre nicht verschwenden für etwas, das mit meinem Kunstbegriff nicht vereinbar ist“, sagt sie: „Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was für mich Theater sein soll.“

Sie startete das Projekt, das heute Bluespots Productions heißt. Sie schrieb Stücke, suchte Gleichgesinnte und führte ihre Produktionen dort auf, wo sie ihrer Meinung nach hingehörten. Die Wohnung eines Professors für ein Stück, bei dem sich die Handlung um eine Universität dreht. Ein Schwimmbad, wenn „Undine“ aufgeführt wurde – die Geschichte eines Mädchens, das sich in eine Meerjungfrau verwandelte. Die Zuschauer trugen Badehosen und Bikinis und sprangen nach dem Stück ins Becken, auf dessen Boden eine Fotoausstellung zum Stück aufgebaut war. „Das Publikum muss ein Gefühl verbinden mit dem Stück. Und Undine dachte, sie könne nicht an Land atmen. Also sollte das Publikum auch das Gefühl bekommen, nicht atmen zu können.“
Die Bilder waren eigens für das Stück angefertigt worden. Denn auch das gehört zur Idee von Bluespots Productions: dass Schauspieler mit anderen Kreativen zusammenarbeiten. Mit Malern, Bildhauern oder Tänzern. Und dass sich jeder in den Gewerken der anderen versuchen kann. „Ein Schauspieler, der bei uns spielt, probt nicht nur den Text, führt das auf und geht wieder, sondern geht auch mal mit der Stecknadel an sein eigenes Kostüm oder baut die Technik auf.“
„Das ist ein ganz anderes Teamgefühl“, sagt Lisa Bühler, neben Pichler und Martin de Crignis eine der drei Vollzeitkräfte, die Bluespots Productions mittlerweile zählt. Allerdings zu Gehältern, die nur zum Leben reichen, wenn man in einem WG-Zimmer wohnt und jeden Tag gemeinsam kocht. Aber Geld sei ohnehin nicht die Motivation, sagt Martin. „Unser Credo ist, tolle Projekte mit tollen Künstlern zu machen.“

Immerhin, mit Sponsoring und Werbung steigern die Bluespots Productions stetig ihre Umsätze. Wie sie in diesem Bereich noch erfolgreicher sein können, haben sie auch bei den Kultur- und Kreativpiloten gelernt. Etwa durch neue Formen, mögliche Sponsoren anzuschreiben. Für ihre neue Inszenierung „Schuld und Bühne“ schrieben sie Anwaltskanzleien mit einem Text im Urteilsstil an – eingepackt in eine Aktenmappe. „Das war eine Idee von den Coaches. Die sagten: ihr seid nicht konventionell, also könnt ihr auch unkonventionelle Anschreiben machen“, sagt Lisa: „Und es hat funktioniert, die ersten Rückmeldungen sind sehr positiv.“
Und sie lernten noch etwas bei den Kultur- und Kreativpiloten. „Wir haben uns überhaupt erstmal als Unternehmer verstanden“, sagt Leonie. Bis hin zu Rollenspielen. „Da musste ich mich vorstellen: Guten Tag, mein Name ist Leonie Pichler, ich bin Unternehmerin“, erzählt sie lachend, „das war gut für unser Selbstbewusstsein.“ Klar ist aber auch, dass das Ziel nicht heißt, auf Dauer immer mehr Gewinn zu machen. „Sonst sind wir auf Dauer nur eine weitere Musical-Company.“ Bessere Produktionen, mehr Zuschauer, vielleicht ins Ausland gehen – das sind ihre Ziele für die Zukunft. „Für mich ist ein Unternehmer jemand mit Schöpfergeist. Jemand, der den Willen hat, etwas zu kreieren.“ Inzwischen verstünde dies auch ihr Vater, sagt sie. „Neulich hatten wir ein Gespräch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Da haben wir fast zwei Stunden lang mal richtig gequatscht – von Unternehmer zu Unternehmer.“
NUR AUF DER META-EBENE ARBEITEN IST NICHTS FÜR MICH. ICH WILL AUCH SELBST DINGE BAUEN.

Ich will Erfinder werden!“ Das hat Julian Adenauer schon in der Schule allen erzählt. Er lacht: „Okay, ein Grund dafür war auch, dass ich es witzig fand, das zu sagen.“ Der andere Grund: „Ich wollte Dinge bauen. Dinge, die sich bewegen.“ Aber gleichzeitig war da der Wunsch nach etwas Künstlerischem, nach Kommunikation. Darum ging Julian als Schüler in die Theater-AG, die Video-AG, die Schülerzeitung. Fast hätte er einen Beruf in den Medien gewählt. „Aber das war mir nicht herausfordernd genug.“ Heute hat er einen Job gefunden, der alles vereint. „Ich bin eine Art Übersetzer“, sagt er. Zwischen Technik, Kommunikation und Kunst.
Um diese drei Welten geht es auf der „Retune“. Einem Kongress in Berlin, auf dem sich jedes Jahr Künstler, Ingenieure, Designer und Wissenschaftler treffen. Menschen, die wissen wollen, wie Technik unsere Art uns auszudrücken, zu leben und zu arbeiten, verändert. Sie stellen Kunstwerke mit 3D-Druckern her. Demonstrieren live, wie fahrlässig Daten über ungeschützte W-Lan-Netze versendet werden. Lassen Männer und Frauen durch die Augen des anderen Geschlechts sehen, indem sie sie über Virtual-Reality-Brillen zusammenschalten.

Für das Retune-Projekt wurde Julian als Kultur- und Kreativpilot ausgezeichnet. Aber als Event-Veranstalter sieht er sich nicht. Denn die Retune ist nicht gedacht als eine Veranstaltung, bei der die eine Seite etwas präsentiert und die andere konsumiert. „Jeder zweite, der im Publikum sitzt, könnte auch auf der Bühne stehen“, sagt er. Und das schließt ihn mit ein. Statt in die Medien zu gehen, studierte er schließlich Mechatronik. Denn da lernt man, wie man Roboter baut. Viele Kommilitonen gingen mit diesem Wissen zu großen Autokonzernen. Julian bastelt lieber an freakigen Maschinen, die keine Konsumprodukte herstellen, sondern: Spaß. Kunst. Lebensfreude.
Zum Beispiel den Facadeprinter: Eine robotergesteuerte Paintball-Kanone, die Farbklecks um Farbklecks überdimensionale Bilder auf Häuserwände schießt. Käufer fand das Gerät nicht, dafür wird Adenauer immer wieder für Aktionen gebucht, bei denen er Kunstwerke an Wände schießt. So machte er sich einen Namen als einer, der die Visionen von Künstlern technisch umsetzen kann, zum Beispiel eine Scheinwerferinstallation von Angela Bulloch, bei der die Lichtkegel vom Wind gelenkt werden sollten. Adenauer schrieb ein Lastenheft, das festhielt, was die Installation können soll, kümmerte sich um Computer und Programmierung. „Ich verstehe, was die Künstler wollen, das unterscheidet mich von anderen Ingenieuren.“

Aus diesem Grund stieg er 2012 bei der Retune ein, die damals noch unter einem anderen Namen stattfand. „Dort geht es nicht um die Start-up-Szene, sondern um etwas Künstlerisches.“ Ein Jahr stieg sein Partner aus, seitdem investiert Julian über das Jahr verteilt rund drei Monate Arbeitszeit in das Projekt. Das Eintrittsgeld reicht gerade, um die Kosten abzudecken – die Arbeitszeit von Julian und mehreren freiwilligen Helfern nicht eingerechnet.
„Bei den Kultur- und Kreativpiloten habe ich viele Leute getroffen, die genauso denken, die kein Produkt entwickeln, weil man das verkaufen könnte, sondern weil sie für die Sache brennen“, sagt er, „da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt.“
Trotzdem ging es dort auch um Geld. „Wir haben viel darüber diskutiert: Für wen ist Retune noch interessant?“ Könnte man Innovationsworkshops veranstalten, die sich speziell an kleine oder mittelständische Unternehmen richten? Wäre der Kongress nicht auch als Recruiting-Veranstaltung für Werbe-, Marketing- oder Musikfirmen interessant, wenn doch dort so viel geballtes Fachwissen herumläuft? Gäbe es Teilnehmer, die Interesse an Vip-Tickets hätten, die ein Abendessen mit einem der Speaker beinhalten? Oder an einer Summer School?

Dieses Jahr setzt die Retune aus, weil Julian auch an solchen Vorschlägen arbeiten will. „Aber das Ziel ist nicht, dass das eine große Cash-Cow wird. Ziel ist, dass alle, die mitarbeiten, für ihre Arbeitszeit Geld bekommen, mich eingeschlossen“, sagt er, „Und im Zweifel entscheide ich mich immer für das Programm und gegen den Sponsor.“
Er hätte es leichter haben können. Vergangenes Jahr bot ihm eine Agentur eine Stelle als Programmleiter für Innovationsworkshops an, die Retune wäre integriert worden.“ Julian dachte nach – und sagte nein. „Nur organisieren und nur auf der Meta-Ebene arbeiten, ist nichts für mich. Ich will auch selbst Dinge bauen.“
WENN ZWEI LEUTE LOSLEGEN, KÖNNEN SIE HUNDERT MITZIEHEN.

igentlich wollten Max Beckmann und Robin Höning nur eine einzelne Skateboard-Rampe bauen. Weil da diese ungenutzte Gewerbefläche in ihrem Heimatort Hannover war. Weil sie gern skaten. Und weil sie es konnten. Aus der Rampe wurde ein ganzer Skatepark. Und aus einem einzelnen Projekt wurde Endboss Projects – ein Unternehmen, mit mehreren Geschäftszweigen, von dem sie leben. Aber das Konzept ist geblieben: „Wir haben Bock darauf, also machen wir das.“
„Beim Bau der Anlage haben wir gemerkt, dass uns das liegt: die körperliche Arbeit, Entwürfe machen, und vor allem: viele Leute zusammenzubringen.“ Denn die Anlage war das Werk von vielen Freiwilligen. Dafür braucht man keinen Boss, stellten sie fest. „Wer mitmacht, entscheidet selbst, wie er es macht.“ Was man aber braucht, ist jemand, der die anderen motiviert. Darum packten Max und Robin immer mit an: „Wenn zwei Leute loslegen, können sie hundert mitziehen.“ Aber sie packen auch mit an, weil sie nicht anders können: „Wir hätten uns manchmal zurückziehen können. Aber wenn man das Gewusel erstmal sieht, dann denkt man: Ich muss was tun. Ich halte das gar nicht aus, nur zuzusehen.“
Irgendwann kam zur Skateboard-Anlage ein Skateboardwettbewerb hinzu, dann wurde aus dem Wettbewerb ein Festival. Und schließlich erkannten Max und Robin, dass sie mit dem, was sie gelernt hatten, auch Geld verdienen können. Bei ihrem ersten Auftrag ging es nur um ein paar kleine Rampen. Die Hälfte des Auftragswerts von ein paar tausend Euro mussten sie im Voraus kassieren, um das Werkzeug zu kaufen. Dann wurden die Anlagen größer, bis zu 900 Quadratmetern. In Hannover, in Chemnitz, in Oberhausen, auf Rügen, überall.

Und jedes Mal stellten sich die Endbossse anschließend die Frage: Was kommt als nächstes? „Wir haben uns immer überlegt: Was können wir mit dem, was wir haben, noch anstellen?“, sagen sie: „Bei den Kultur- und Kreativpiloten haben wir gelernt, dass man das Effectuation nennt.“
Effectuation heißt auch: experimentieren, Chancen nutzen und Partner gewinnen, an die man zuvor gar nicht gedacht hätte. Die Jeansfirma Levi Strauss zum Beispiel, die sich gerne in der Skater-Szene etablieren wollte – und in dem Endboss-Duo die perfekten Markenbotschafter fand. Die taten mit dem PR-Etat des Jeansmultis genau das, was sie ohnehin gern tun: Skateparks bauen. Aber diesmal begleitet von einem Kamerateam – und in Ländern, die nicht gerade als Skater-Hotspots gelten. Erst in Indien, dann in der dünnen Höhenluft Boliviens. „In der deutschen Botschaft von La Paz haben sie uns gesagt: das klappt nie“, sagen sie, „aber wir haben den Gedanken, dass wir unbesiegbar sind und den unbändigen Drang, alles immer hinzubekommen.“ Der Plan ging auf – trotz mangelnder Sprachkenntnisse, korrupter Behörden und unzuverlässigen Lieferanten.
Im geordneten Europa gingen Max und Robin subversiver ans Werk: Sie kauften einen doppelstöckigen Oldtimer-Bus, den sie mit Werkzeugen, Betonmischer und Stromgenerator beluden – eine rollende Baustelle, mit der das Endboss-Team für Levi’s durch Europa fährt und in Guerilla-Aktionen Skaterampen hochbetoniert.

„Was wir bei solchen Aufträgen verdienen, stecken wir in Projekte, die uns Spaß machen“, sagen Max und Robin. Als sie ins Kultur- und Kreativpilotenprogramm aufgenommen wurden, vereinigten sie unter dem Dach Endboss eine Skateparkfirma, drei gemeinnützige Vereine und einen Verlag für erotische Kurzgeschichten. Und merkten zum ersten Mal, dass sie an eine Grenze stoßen. Zu viel Tagesgeschäft, zu viel Bürokratie auf einmal. „Wir waren am Rand unserer geistigen und körperlichen Kräfte.“ Schlimmer noch: „Wir hatten nicht mehr die Kapazität, etwas zu entwickeln. Das war kaum zu ertragen.“
Loslassen – das war die Botschaft, die sie aus den Workshops und den Gesprächen mit den Coaches mitnahmen. „Sie haben uns davon überzeugt, jemanden einzustellen, der sich um Dinge wie Steuern und Buchhaltung kümmert. Das war für uns ein großer Schritt. Bislang wollten wir immer alles selbst in der Hand haben.“ Sie zogen Strukturen in ihre Projekte ein, damit die Dinge auch ohne sie laufen. Sie führten einen regelmäßigen „Zukunftstag“ ein, an dem sie nur an neuen Ideen arbeiten. Und sie zogen sich gleich ganz aus einzelnen Bereichen zurück, etwa dem Vorstand des Platzprojektes – eine Art Gründerzentrum auf der Brache neben dem Skateboardplatz, wo Kreative in ausrangierten Schiffscontainern Fahrräder schweißen, Möbel bauen, Mode entwerfen, Kunst machen und Cafés eröffnen
Jetzt ist wieder Platz für Neues. Die nächste Tour mit dem Baustellenbus läuft bereits. Und danach wollen Robin und Max Workshops anbieten: „Wir haben so viele Fähigkeiten bei uns Projekten erworben – das können wir weitergeben. Wir möchten Leuten den Mut geben, einfach loszurennen.“
MAN DARF SICH NICHT AN EINER EINZIGEN IDEE FESTBEISSEN, SONST VERLIERT MAN DIE INSPIRATION.

nd plötzlich war es nicht mehr da. Dieses Parfüm, das Daniel Plettenberg so liebte. Es wurde einfach nicht mehr hergestellt. Ein mittlerer Schock für einen Mann, der von sich selbst sagt, er sei verrückt nach Parfüm. Der eine Sammlung von mehr als 100 Düften besitzt. Der das erste Geld, das er als Zwölfjähriger mit Gartenarbeiten verdiente, für Parfüm ausgab. Und der auf seiner Liste von „Dingen, die man im Leben einmal tun sollte“ stehen hatte: ein eigenes Parfüm kreieren. „Ein sehr erfolgreicher Mensch hat mir mal gesagt, dass man nie sagen sollte: Das müsste man mal machen. Wenn dieser Gedanke aufkommt, muss man sich hinsetzen und einmal durchspielen: Ginge das?“ Also setzte er sich hin und entschied: Das geht.
Mit diesem Willen zum Ausprobieren haben Daniel und seine Geschäftspartnerin Stefanie Mayr die Kultur- und Kreativpiloten-Jury überzeugt. Aber auch, weil sie es sich bei ihrer Aufgabe nicht leicht gemacht haben: Sie nennen ihren Duft „Dreckig bleiben.“
Dinge zusammenführen, die scheinbar nicht zueinander passen – darin hat Daniel Erfahrung. Mit Anfang 20 stand er das erste Mal als Drag Queen auf der Bühne. Ursprünglich, weil er nach seinem Coming-Out ein bisschen herumexperimentieren wollte. „Aber dann merkte ich, dass ich dort alles sein konnte, was ich sein wollte: eine erfahrene Reporterin, eine taffe Geschäftsfrau, eine Moderatorin“, sagt er. „Ich habe gelernt: Wenn ich eine Rolle gut erfinde, wird sie wahr. Und das gilt für mein ganzes Leben.“

Entscheidend sei, dass man die passenden Worte findet, sagt Daniel. „Eigentlich bin ich ein Geschichtenerzähler.“ Und das auch außerhalb der Bühne. Seit knapp 20 Jahren verdient er sein Geld damit, Unternehmen mit Ideen und Konzepten für Werbekampagnen, neue Produkte oder Produktnamen zu beliefern. Vom Duschgel bis hin zum Geländewagen. „Ich habe die einfach angeschrieben und gesagt, was ich kann“, sagt er. Und dann spinnt er wie zum Beweis aus der hohlen Hand eine Idee, wie man das Produkt Fischölkapseln mit Gold assoziieren kann, mit Tiefen des Meeres und dadurch wiederum mit Märchen, bei denen Perlen in tiefe Brunnen fallen. „Alles eine Frage des Wordings.“
Darum war die Idee seiner Bekannte Stefanie, in deren Designartikel-Shop er immer sein Lieblingsparfüm gekauft hatte, eine Herausforderung. „Sie sagte: Wenn wir unser eigenes Parfüm machen, dann muss es etwas Ungewöhnliches sein.“ Eines, das Menschen an Situationen denken lässt, in denen sie sich besonders wohl fühlen. Im Freien, am rauchigen Lagefeuer, den eigentlich zu warmen Wein in der Hand. Und das sind nicht immer die Situationen, in denen sie von angenehmen Düften umgeben sind.

„Der Name ist die größte Antithese zu allem, was Parfüm bedeutet“, sagt Daniel. „Vielleicht aber funktioniert es gerade deswegen.“ Er musste nur die Geschichte richtig erzählen.
Er erzählte sie einem renommierten Parfümdesigner, der sich darauf einließ, ohne Bezahlung zu arbeiten. Dafür durfte er alle Stoffe einzusetzen, die er für passend hielt – auch wenn das dazu führte, dass eine Flasche im Handel 120 Euro kostet, von denen Atelier PMP (Perfumes Mayr Plettenberg) gerade mal ein paar Euro Reingewinn bleiben. Chemikalien, die bei den meisten Parfüms dafür sorgen, dass diese auf jeder Haut möglichst gleich riechen, ließ er dafür weg. „Darum riecht ‚Dreckig bleiben‘ bei jedem Menschen anders“, sagt Daniel und grinst: „Und ganz ehrlich: Manche sollten es darum lieber nicht benutzen.“

Auch den Medien erzählte er diese Geschichte. Als erstes der New York Times und angesagten japanischen Modebloggern. „Warum sollten wir erst zur Lokalzeitung gehen? Runterstufen kann man immer.“ Und sogar bei einem saudischen Importeur, der zufällig von „Dreckig bleiben“ erfuhr, kam die Story an. „Die Idee funktioniert in jeder Kultur. Er sagte mir: In der Wüste am Feuer fühlen wir uns am wahrhaftigsten.“
Aber ein Detail fehlt noch in der Geschichte von „Dreckig bleiben“: Wo wollen wir hin mit diesem Produkt? Das einzige Ziel lautete: 1000 Flaschen vom eigenen Parfüm herstellen lassen. Das hat geklappt. Würden alle 1000 Flaschen verkauft, hätte Atelier PMP die Kosten wieder drin. Das hat trotz großem Medienecho und dem Interesse einiger Parfümhändler noch nicht geklappt.

Genau darum ging es bei den Kultur- und Kreativpiloten. „Die Coaches waren fantastisch. Sie fragten uns: Was wollt Ihr denn sein? Ideengeber? Parfümproduzenten? Oder Ihr habt einfach nur ein nettes Hobby?“ Die Antwort haben Stefanie und Daniel noch nicht endgültig gefunden. Aber sie haben Anstöße aus den Coachings umgesetzt: Die PR und den Vertrieb von PMP managet jetzt eine Agentur. Über neue Ideen beraten die beiden zu fest vereinbarten Zeiten statt auf Zuruf. Und tatsächlich läuft der Verkauf der Parfüms besser und besser, gerade verhandeln die beiden mit einem Unternehmen, das Badezimmer von Designhotels mit Kosmetikartikeln ausstattet.
„Wir sind jetzt an einem Scheidepunkt. Vielleicht können wir wirklich Geld damit verdienen“, sagt Daniel. Aber einen Businessplan schreiben? Eine Firma mit festen Büros und Angestellten planen? Auf keinen Fall. „Ich habe ein paar Jahre zwischendurch eine Beratungsagentur geleitet. Da fühlte ich mich wie ein Angestellter und nicht wie ein Kreativer.“ Und überhaupt: „Man darf sich nicht an einzigen Idee festbeißen, sonst verliert man die Inspiration für neue Ideen.“ Aber vielleicht gehe es ja, indem man einzelne Aufgaben auslagere und weitere Produkte erfinde. Neue Düfte, ein Duschgel, ein Shampoo, eine passende Decke für die Araber. „Das würde ich sofort machen“, sagt Daniel. „Da kann man immer neue Geschichten erzählen.“